Der amerikanische Traum ist humorlos und weckt die falschen Hoffnungen: Dass nämlich der Einzelne, wenn er nur wolle, erfolgreich sein könne. Eine Polemik.
Die Macht, die die Hoffnung über uns haben kann, fiel mir das erste Mal auf, als ich in Meidling einen Freund besuchen wollte, der nicht daheim war. Seine Freundin aber schon, und es stellte sich heraus, dass die beiden Streit gehabt hatten und dass er sich daher für ein paar Tage zum Skifahren verabschiedet hatte und genau an dem Tag zurückkommen sollte, als ich von Graz nach Wien kam, um ihn zu besuchen. (Man sieht: Das war noch vor der Massenverbreitung von Handy und SMS.)
Die Freundin des Freundes und ich spazierten zum Zeitvertreib um den Häuserblock. Als wir nach einer ausgedehnten Runde durch das Viertel zurückkehrten und auf das Haus zugingen, wo sie und ihr/mein Freund wohnten, sagte die Freundin: "Das Licht ist an. Der Kurt ist schon da." Ich blickte die Fassade hinauf und war mir nicht sicher, welche Fenster zu ihrer Wohnung gehörten. Als wir jedoch vor der Wohnungstür standen und klingelten, damit Kurt drinnen aufmachte, stellte sich heraus, dass sich die Freundin getäuscht hatte: Es war gar kein Licht in der Wohnung; mein Freund war noch nicht zurückgekehrt.
Paulus war Amerikaner
Manchmal schaltet die Hoffnung dort ein Licht ein, wo gar keines leuchtet. Und das kann für den Betroffenen schön sein, der sich dieses Licht ersehnt. Allerdings ist die Krux daran, dass gleichzeitig der Lichtschalter in unserem Hirn ausgeschaltet wird: Wo jemand hofft, setzt der Verstand aus. Man sieht Dinge, die es nicht gibt, nur weil man sie ersehnt. Das mag im Einzelfall je nach Betrachtungsweise angenehm oder unangenehm sein, im Großen und Ganzen aber wird es zum Problem, wenn eine ganze Gesellschaft auf das Prinzip Hoffnung abfährt. In diesem Sinn war der Apostel Paulus der erste Amerikaner, als er den Korinthern in seinem "Hohelied der Liebe" Folgendes ins Stammbuch schrieb:
Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, / Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht./ Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk,/ Dann aber werde ich durch und durch erkennen, /so wie ich auch selbst durch und durch erkannt worden bin. / Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, / diese drei; / doch am größten unter ihnen ist die Liebe.
Im Zustand, wo das Erkennen Stückwerk ist, bleiben, das hat Paulus schön formuliert, Glaube, Hoffnung, Liebe. Interessanterweise stellt der Apostel des frühen Christentums nicht nur die Liebe über die Hoffnung, sondern auch die Hoffnung über den Glauben. Der Glaube kann schwach werden, die Hoffnung aber stirbt zuletzt. Und überlebt selbst die Liebe mit Leichtigkeit.
Eingespannt zwischen Schlagerseligkeit, biochemischen Prozessen im Körper und psychologischen Deutungen hat es die Liebe in den letzten Jahrhunderten glatt in der Luft zerrissen. Übrig geblieben ist das jugendfrische Brodeln des Begehrens, bei dem das Herz hüpft und das Hirn schmilzt. Dieses Bild der Liebe, das die Zuschauermassen des öffentlich-rechtlichen wie auch des privaten Fernsehens vor die Bildschirme lockt, korreliert mit dem Gefühl von Geborgenheit, Begeisterung und einem verstärkten Sich-selbst-Empfinden, das gerne mit individueller Verwirklichung verwechselt wird.
Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden - außer, dass uns diese Vorstellung von der Liebe auf eine falsche Fährte lockt. Sie verführt zu jener Hoffnung auf persönliche Freiheit in einer Gesellschaft, die ihre Konformitätszwänge mit dem Mantel der Selbstverwirklichung bedeckt. Früher oder später kommen dann einige drauf, dass der Ort, wohin "sein Herz ihn trägt", lediglich das Shoppingcenter ist; und wenn man einmal gelernt hat, hinter dem Glitzer und Glücksversprechen der vollgestopften Regale das Eigentliche zu erblicken - nämlich den Müll von morgen -, wird man jäh aus dem Träumeland verscheucht, das uns das Paradies auf Erden vorgaukeln soll.
Diese Einsicht hilft freilich jenen wenig, die das Licht der Liebe dort sehen, wo keines mehr leuchtet. Aber der Gedanke könnte uns anregen, jenseits der persönlichen Liebesverwirklichung die Perspektive aufzuweiten zu einer Utopie, die nicht nur das individuelle, endorphingesteuerte Glück, sondern die kollektive Zufriedenheit im Auge hat.
Wenn man die Liebe wohl oder übel aus dem Dreischritt Glaube - Hoffnung - Liebe streicht, bleiben Glaube und Hoffnung, und siehe da, wir sprechen vom amerikanischen Traum: Du kannst alles erreichen, wenn du nur fest daran glaubst und hart genug hoffst! Diese Botschaft wird uns tagtäglich eingebläut, das Hohelied der Hoffnung wird in Filmen gesungen, es regnet täglich vom elektronischen Himmel der Medien und hat unser Grundwasser längst kontaminiert. Paulus war in diesem Sinn nichts anderes als Obamas Vorprediger.
Mit seinem "Hope"-Wahlkampf und seinem "Yes, we can!" blendete Barack Obama als Präsidentschaftskandidat anno 2008 alle, die an eine bessere Welt glauben wollten - von den amerikanischen Wählern bis hin zum schwedischen Nobelpreiskomitee -, mit dem gleißenden Licht der Hoffnung. Und was hatten Amerika und die westliche Welt in seiner Amtszeit davon? Foltergefängnisse, deren Schließungen immer nur angekündigt wurden; einen sich stetig öffnenden Graben zwischen Arm und Reich; die fortschreitende Zerstörung der ökologischen Ressourcen und die totale Überwachung der globalen Kommunikation, die Orwell wie einen Optimisten aussehen lässt.
Enttäuschung Obama
Es wäre leicht, den ehemaligen Präsidenten dafür zu schelten. (Und es wäre hart im Wissen darum, welcher Horrorclown ihm nachfolgte.) Aber man muss sehen, dass der angeblich mächtigste Mann der Welt, der in seinem durchgetakteten Leben ungleich weniger persönliche Freiheit besitzt als jeder Obdachlose, vermutlich dem eigenen Blendwerk auf den Leim gegangen ist.
Selten hat jemand so viele Hoffnungen geweckt und so viele enttäuscht wie Obama. Nein, er war nicht zu beneiden. Nicht Obama, sondern ein kühl kalkulierender, totalitärer Technokrat wie Putin ist das eigentliche Erfolgsmodell, wenn es darum geht, sich die politische Macht im 21. Jahrhundert zu sichern. Das mag uns nicht gefallen. Putin ist das egal. Er sitzt in seinem Keller und lacht sich darüber ins Fäustchen, dass sich die demokratische westliche Welt munter selbst desavouiert - mit der Kraft der Hoffnung in Gestalt des amerikanischen Traums.
Der amerikanische Traum ist ein Lebenskonzept, das mit seinem Übermaß an Egomanie und Selbstüberschätzung in vielerlei Hinsicht dumm ist: Es wird durch die Unterhaltungspropaganda aus Hollywood über den ganzen Globus verbreitet wie ein Virus und setzt sich unhinterfragt in den Hirnen von Generationen von Menschen fest, die alle meinen, das Licht in ihrem Leben sei an. Wenn sie nur hart genug wollten, hart genug daran arbeiteten, könnten sie erreichen, was sie möchten - in Hollywoodfilmen mitspielen, Millionär werden, auf den Mars fliegen...
Der amerikanische Traum ist so humorlos wie die Hoffnung selbst. Verbissen arbeitet er sich am Leben ab und spuckt die Verlierer abgenagt und ausgezehrt aus. Der amerikanische Traum trägt einen Backenbart und beharrt darauf, dass die Erde am 6. Jänner 4523 v. Chr. von Gott höchstpersönlich erschaffen wurde.

"Mich kümmert einzig, was ich zu tun habe, nicht was die Leute denken", schreibt Ralph Waldo Emerson, der zweite Prediger des amerikanischen Traums (nach Paulus). Emerson formte den amerikanischen Traum zu einem individualistischen Konzept um. Es ist geprägt vom Pioniergeist der weißen Siedler im 19. Jahrhundert, die Nordamerika eroberten und dabei über die Leichen der Indigenen gingen. Daher ist der amerikanische Traum ohne Reue; er ist unsozial, hart und im Endeffekt rücksichtslos auch dem Einzelnen gegenüber: "Und erzählt mir nicht, wie heute ein guter Mann getan, dass ich verpflichtet sei, die Lage aller armen Leute zu verbessern. Sind sie meine Armen?", schreibt der Essayist Emerson in einem seiner zentralen Aufsätze, "Self-Reliance" (im Deutschen manchmal als "Selbstvertrauen" und manchmal als "Selbstständigkeit" übersetzt). An dieser Stelle muss man ergänzen, dass Emerson lange Zeit der am öftesten zitierte Denker in der Zeitschrift "Reader’s Digest" war, die nach dem Zweiten Weltkrieg das Weltbild von bis zu siebzig Millionen Lesern monatlich prägte. Die Kernbotschaft Emersons, auf den sich implizit auch etliche Strohsäcke und Strohköpfe der heimischen Politik berufen, insbesondere jene, die sich länger in Nordamerika aufhielten und -halten: Wer sich in der Wildnis des Lebens nicht behaupten kann, ist ein Versager ohne Lebensberechtigung.
Lachender Putin
Diese Trapper-Mentalität ist die wahre Botschaft des amerikanischen Traums, der uns in seiner Zuckerwatteversion in immer neuen Formen aufgetischt wird. Zillionen von Filmen erzählen die Saga von der Selbstbehauptung und Durchsetzungskraft des amerikanischen Mannes (und fallweise auch der amerikanischen Frau, sofern sie nur - wie Erin Brockovich - genug Pioniergeist besitzt und mit einer Flinte, den Paragrafen oder sonstigen Waffen umzugehen weiß). Aber keine zehn US-Filme fallen mir ein, die sich mit den Komplexitäten und ökonomischen Grundlagen des sozialen Lebens beschäftigen.
Die Absurdität dabei: Während in den letzten Jahrzehnten rund um den Globus immer mehr anonyme, gesichtslose Strukturen gewuchert sind - globale Konzerne, elektronische Kommunikationsnetze, multinationale Wirtschaftsverflechtungen -, die unser Denken und Handeln beeinflussen, die unser Wissen kanalisieren und uns von der Geburt bis zum Abtreten fest im Griff ihrer Notwendigkeiten haben, glauben wir noch immer, es käme auf uns als Einzelne an.
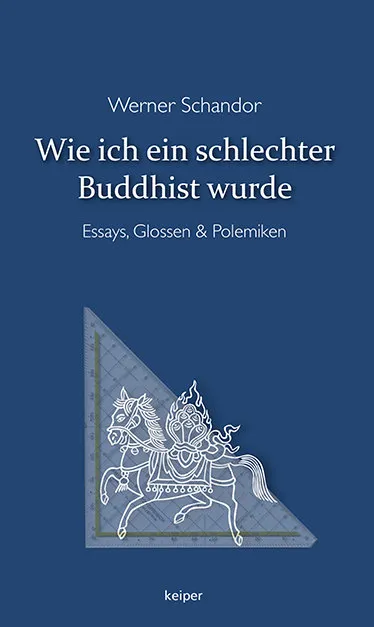
Als ob der Einzelne im Regelfall irgendwelche Meter gegen die Übermacht der Lobbyisten und Maschinisten der globalen Ökonomie hätte! Putin sitzt im Keller und lacht sich ins Fäustchen. An seiner Seite Xi Jinping. Sie trinken Reisschnaps und stoßen auf uns Idioten an, die wir den Amerikanern alles glauben - und den Chinesen alles abkaufen.
Über Bord mit der Hoffnung, dass die Welt sich bessert, indem man das richtige Müsli kauft. Man stelle sich lieber der Realität: dass uns der amerikanische Traum in den Abgrund führt. Gibt es Gegenkonzepte zu diesem Hoffnungsschwindel, der unsere Kultur durchzieht? - Vermutlich genug. Und sie haben vermutlich alle miteinander mit einem Mehr an Solidarität zu tun. Aber ich bin nicht Paulus, ich habe kein bibeltaugliches Rezept auf Lager, wie man sich gegen die Zumutungen der Hoffnung zur Wehr setzen kann. Ich weiß nur, dass man es tun sollte. Warum? - Um nicht alle Hoffnung fahrenzulassen. Denn das wäre die Hölle.
Werner Schandor, geboren 1967, lebt als Autor, Journalist und
Fachhochschullektor in Graz. Der Text ist die gekürzte Version eines
Essays aus seinem neuesten Buch, "Wie ich ein schlechter Buddhist wurde", Essays, Glossen & Polemiken (Edition Keiper, Graz 2020, 200 Seiten, 22,- Euro).
